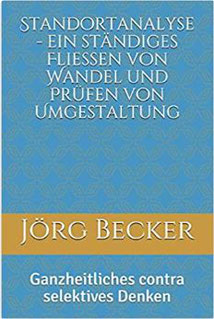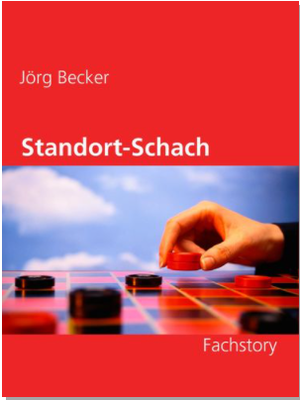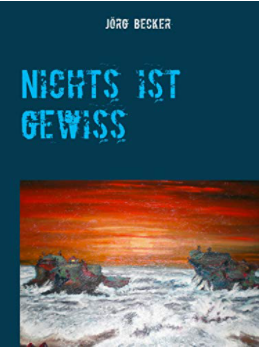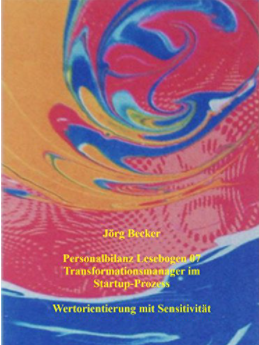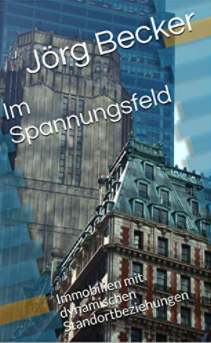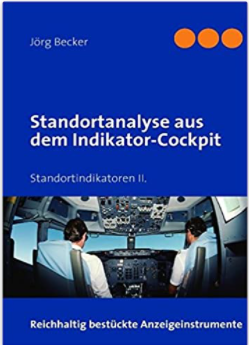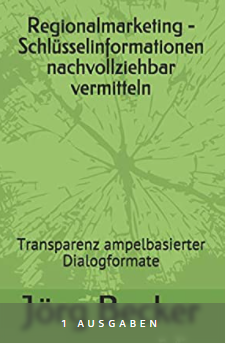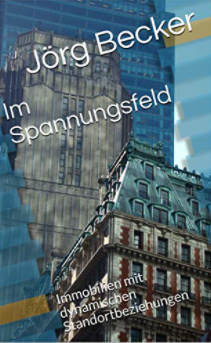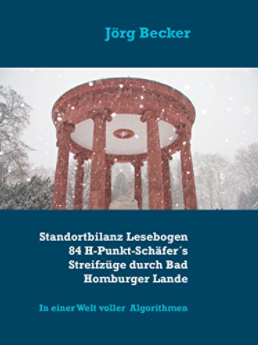„Beurteilungen von Einzelaspekten sind meist nur eindimensional ausgerichtet.“
„?“
„Oft lassen sich zusätzliche Erkenntnisse damit gewinnen, dass der Faktor nicht immer nur mit einer Blickrichtung und unter einem einzigen Aspekt beurteilt wird.“
„Sondern?“
„Mit einem Prinzip der 3-fach-Bewertung können sich neben beispielsweise der bloßen Quantitätsbetrachtung weitere Facetten, nämlich die der Qualität und Systematik, erschließen.“
„Und?“
„Jeder der Einflussfaktoren sollte für sich einzeln beurteilt werden. Jeder einzelnen Beurteilung sollte ein möglichst ausführlicher Fragenkatalog vorangestellt werden, mit dem für jeden der Faktoren quasi eine Bewertungs-Checkliste erstellt wird.“
„Wenn in diesem System eine solche Stufe der an jeden einzelnen Faktor zu formulierenden Fragen eingebaut wird, wird damit auch zwangsläufig eine Auseinandersetzung mit vielen wichtigen Sachverhalten in Gang gesetzt?“
„Unbedingt, danach werden für jeden einzelnen Einflussfaktor drei Bewertungen eingetragen: a) nach ihrer Quantität, b) nach ihrer Qualität und c) nach ihrer Systematik.“
„Und jede dieser drei Bewertungen wird ihrerseits wiederum auch ausführlich begründet?“
„Wenn jeder dieser ausgewählten Faktoren einem mehrstufigen, zusätzlich graphisch darstellbaren Bewertungsprozess unterzogen wird, entsteht hieraus ein durchdachtes und anhand konkreter Bewertungsziffern nachvollziehbares Bild des jeweiligen Bewertungsaspektes.“
„Das heißt, aus diesen zahlreichen Einzelbildern lässt sich ein ebenso konturscharfes wie auch genaues Gesamtbild herstellen.“
Ein unabhängiger Beobachter kann dazu beitragen, eine solche Tool-Box zu erstellen. Die Bewertungen auffüllen müssen allerdings die Akteure selbst. Für die Bewertung können beispielsweise %-Zahlen von 0 bis 120 % oder dementsprechende Punktzahlen von 0 bis 12 Punkten vergeben werden. Es kommt also nicht immer nur unbedingt auf die absolute Höhe dieser Werte an. Wichtig ist vielmehr, dass die Werte in der richtigen Relation zueinander vergeben werden.
Wenn alle Werte immer nur im Höchstbereich liegen wäre dies eher ein Hinweis darauf, dass insgesamt zu hoch bewertet worden ist. Nur 100%-Bewertungen würden schlichtweg bedeuten, dass keine weiteren Potenziale mehr auszuschöpfen wären. D.h. es wäre ein kaum realistisches Bild das einer weiteren Überprüfung standhalten würde.
„In einem ersten Schritt würde zunächst also das rein mengenmäßige Vorhandensein eines Faktors danach beurteilt, wie weit dieser den Anforderungen zu entsprechen vermag?“
„Vor dem Hintergrund, dass in vielen Fällen das bloße Vorhandensein vielleicht nicht ausreichen mag, könnte zusätzlich die Qualität des Faktors beurteilt werden.“
„In manchen Fällen mag es durchaus vorkommen, dass fehlende Quantität durch bessere Qualität ausgeglichen werden kann.“
„Sowohl die Dimension Quantität als auch die einer Qualität sind jedoch immer nur vergangenheits- oder bestenfalls gegenwartsbezogene Bewertungsdimensionen.“
„Was darüber hinaus also noch interessiert, wäre wohl eine zukunftsbezogene Beurteilungsbetrachtung?“
„Der mit einer weiterführenden dritten Systematik-Bewertung nachgekommen werden soll.“
„Das heißt, unter diesem Blickwinkel sollte ein Faktor zusätzlich noch danach beurteilt werden, wie er sich voraussichtlich in der nächsten Zukunft weiter entwickeln wird?“
„Beziehungsweise wie stabil und sicher vergangenheits- und gegenwartsbezogene Bewertungen auch für die Zukunft fortgeschrieben werden können.“
„Würde das Bewertungsbild aus diesen drei Dimensionen zusammengesetzt, so wird auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass es besser der Realität entsprechen kann.“
Prinzip Ampelbeobachtung: um dem Ganzen ein Rahmengerüst zu geben, könnten zunächst folgende vier Bewertungszonen unterteilt werden: Bewertungszone rot 0 % - 30 % = schlecht, Bewertungszone gelb > 30 % - 70 % = teils-teils, Bewertungszone grün > 70 % - 100 % = gut, Bewertungszone rot > 100 % = Übererfüllung. Je nachdem, ob ein Faktor hinsichtlich seiner Quantität, Qualität oder Systematik beurteilt und bewertet wird, ermöglicht dies einen schnellen „Ampel“-Eindruck. Die Bewertungszone von > 100 % - 120% würde deshalb vorgesehen, um für einen bestimmten Einflussfaktor gegebenenfalls auch eine „Übererfüllung“ anzeigen zu können. Beispielsweise um darauf hinzuweisen, dass mit über das Optimum hinausreichenden Ressourcen über eine Umleitung zu anderen Faktoren aus ganzheitlicher Sicht ein vielleicht größerer Vorteil zu erreichen wäre.
BUSINESS COACHING – Decision Support mit Ansage
https://www.bod.de/buchshop/business-coaching-joerg-becker-9783739223452
 derStandortbeobachter
Publikationen und Blog
Konzepte und Tools
Standortbilanz - Analyse
derStandortbeobachter
Publikationen und Blog
Konzepte und Tools
Standortbilanz - Analyse