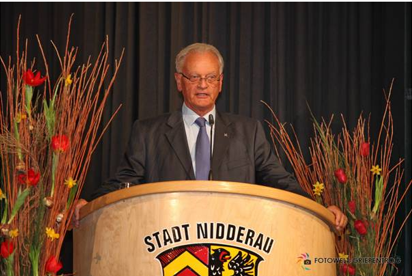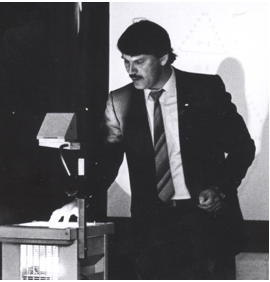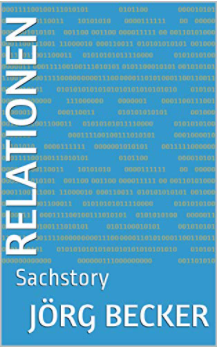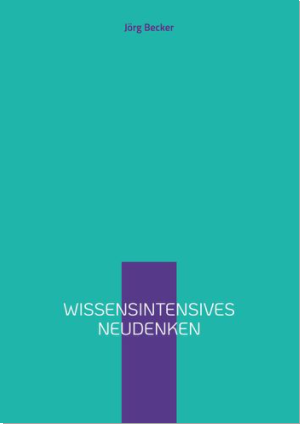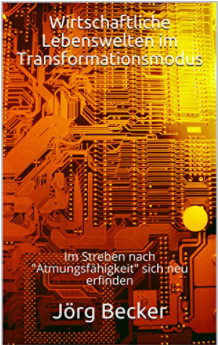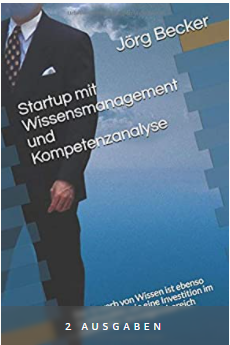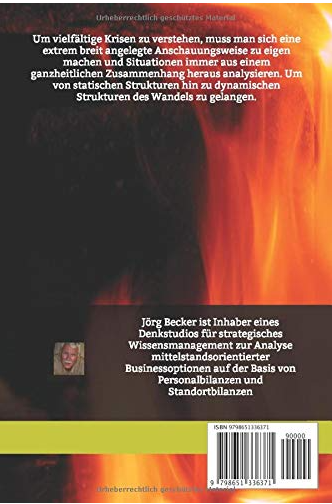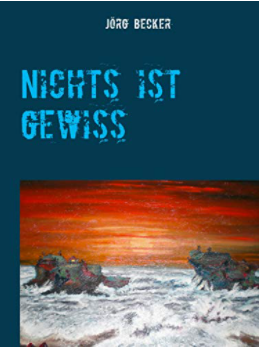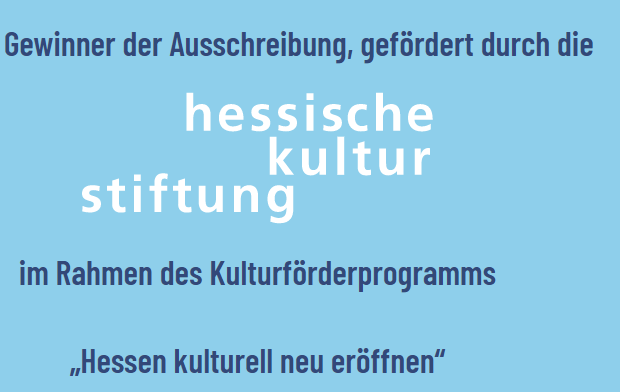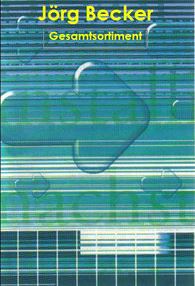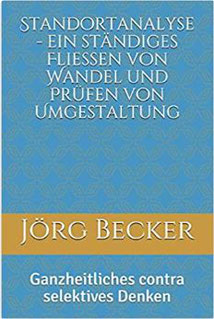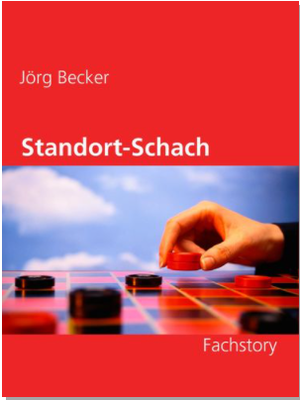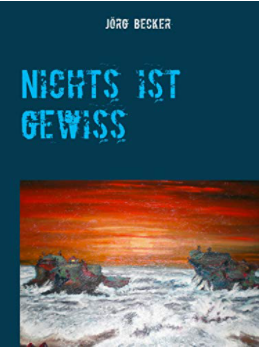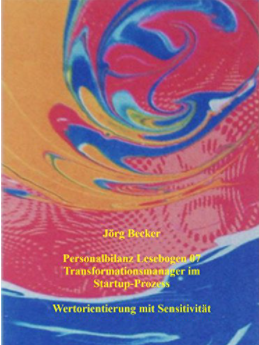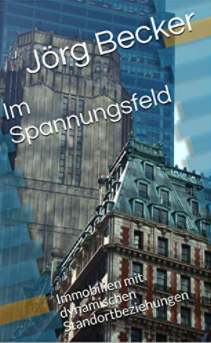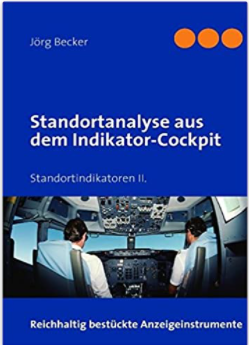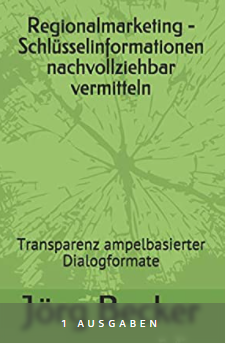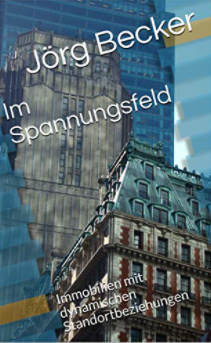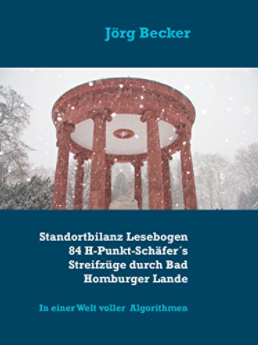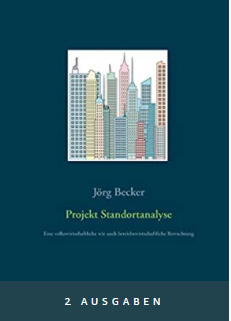In Räumen des Übergangs
MANAGEMENTCOACHING STANDORTWISSEN
Wirtschaftsförderung der Basics
https://www.bod.de/buchshop/managementcoaching-standortwissen-joerg-becker-9783746098463
Diplomkaufmann Jörg Becker
Executive Coaching
Autor zahlreicher Publikationen
Langjähriger Senior Manager in internationalen Management Beratungen
Inhaber Denkstudio für strategisches Wissensmanagement
Future Cloud Community
So mühsam der Entwicklungsprozess einer umfassenden Standortbilanz auch sein mag: der Aufwand lohnt sich. Schon allein deshalb, weil alle Beteiligten neue Erkenntnisse über Zusammenhänge gewinnen und das Verständnis für Probleme wächst. Vor allem Visualisierungen mit entsprechenden Interpretationstexten könnten geeignet sein, um die Bewertungen zu bündeln und nur die wesentlichen Punkte hervorzuheben. Gut für die Glaubwürdigkeit ist, wenn auch Defizite offen gelegt werden. Jedoch sollte man sich auf Schwächen konzentrieren, an denen man auch tatsächlich arbeitet und in den Folgeperioden mit großer Wahrscheinlichkeit Erfolge melden kann. Sollen gezielt Investoren angesprochen werden, kann eine Auswahl der Indikatoren helfen, ein glaubwürdiges Zahlenwerk vorzulegen. Intern sollte auf Nachvollziehbarkeit geachtet werden und dann der Schwerpunkt auf diejenigen Indikatoren gelegt werden, die man entwickeln will.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Künstliche Intelligenz Software System
Leistungsprofil der kommunalen Verwaltung: können Genehmigungsverfahren elektronisch medienbruchfrei abgewickelt werden? werden gezielt individuelle Interessen berücksichtigt, egal ob es sich um Existenzgründer, bestehende örtliche Unternehmen oder speziell für Neuansiedlung angesprochene Branchen handelt? Gilt das „end-to-end“-Prinzip vom Ausfüllen eines Online-Formulars über alle Genehmigungsverfahren bis hin zur Bestätigung an das Unternehmen? werden die sich durch das Internet bietenden Interaktionsmöglichkeiten ausgeschöpft, d.h. wird insbesondere im Bereich Wirtschaftsförderung und Standortmarketing die Zusammenstellung individueller Angebote durch entsprechenden Menüaufbau mit leicht handhabbarer Navigation unterstützt? Ist das virtuelle Rathaus unabhängig von Öffnungszeiten 24h/Tag bzw. 365 Tage im Jahr verfügbar?
Standort, Kommune - Bilanz des Vermögens
Sowohl für das eigentliche angebotsorientierte Standortmarketing als auch für nachfrageorientierte Standortanalysen und -vergleiche haben Vermögensbilanzen für sich alleine eine eher geringe, möglicherweise sogar irreführende Aussagekraft. Grundsätzlich ist nämlich zu bedenken, dass in den derzeit von den Kommunen in Angriff genommenen Vermögensbilanzen ausschließlich harte, d.h. im Sinne der kaufmännischen Buchführung buchbare Faktoren ihren Niederschlag finden. Ein Standort ist mehr als nur die Addition aus buchbaren Einzelwerten, die der Kommune gehörenden Sachanlagen in Form von Gegenständen, Grundstücken, Immobilien, Straßen, Leitungen u.a. beigemessen werden. Einen weitaus höheren Wert stellt das ebenso am Standort befindliche private Eigentum dar. Unabhängig davon muss man bereits im Bereich dieser sogenannten harten Faktoren auch mit Annahmen (z.B. Bodenrichtwerte, durchschnittlicher Lagewert eines Grundstückes) arbeiten). Viele Annahmen müssen dabei unter einem weit dehnbaren Interpretationsrahmen getroffen werden, da große Teile der in der Vermögensbilanz angeführten Sachanlagen unverkäuflich sind und für sie daher manchmal nicht einmal annäherungsweise, d.h. überhaupt kein Marktpreis feststellbar ist.
Kommunale Standort Kommunikation
Eine kommunale Standortbilanz ist kommunikativ, systematisch strukturiert und beantwortet vieles: Die detaillierte und umfassende Bilanzierung von Standortfaktoren gibt eine Antwort darauf, wofür der Standort steht, wie er sich selbst wahrnimmt und wie er von ansässigen und ansiedlungsinteressierten Unternehmen wahrgenommen wird. Eine Standortökonomie setzt einen Prozess des Umdenkens in Gang: es werden Kräfte gebündelt, Kernkompetenzen definiert und vernetzt. Ebenso können die Verfahren als Frühwarnsystem wirken, also dazu beitragen, dass Handlungsbedarfe nachvollziehbar kommuniziert werden.
J. Becker Denkstudio - BigData Inspiration
Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Streuungsmaßen. So beispielsweise die Spannweite, mit der man die Differenz zwischen einem größten und kleinsten Merkmalswert bezeichnet. Bei einer Reihe von Merkmalswerten wie 4,8,15,21,32,55,56,57,60 würde sich eine Spannweite von 60 – 4 = 56 ergeben. Das Problem dabei ist, dass die Spannweite nur die beiden Extremwerte berücksichtigt. Die Verteilung der zwischen den Extremen liegenden Werte kommt also in ihr überhaupt nicht zur Geltung. Besonders bei großen Gesamtheiten kann es aber sein, dass weitaus die meisten Elemente recht nahe beieinander liegen und es nur wenige Ausreißer gibt. Das heißt, die Streuung ist relativ gering, obwohl die nur von den beiden Extremwerten bestimmte Spannweite sehr groß sein mag.
https://www.bod.de/buchshop/hoert-man-auf-treibt-man-zurueck-joerg-becker-9783756216109
Blog Bürgermeister Coaching - Leadership Wirtschaftsförderung
BLOG BÜRGERMEISTER COACHING – LEADERSHIP WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Fiktive Dialoge - ein paar Stunden Intensivcoaching
Denkanstöße
Wissensmanagement
Storytelling
Content
Inspiration
Diskurs
DecisionSupport
Gehirntraining - wenn es gut werden soll
Verstehen lernen
Vernetzt denken
Potenziale ausschöpfen
Komplexität reduzieren
Gestaltbar machen
Wissen transferieren
Proaktiv agieren
In einer Universität spiegelt sich auch immer der intellektuelle Zustand einer Gesellschaft: denn fast scheint es so, als wüssten immer weniger, was eine Universität eigentlich ist (sein soll), welcher Idee sie folgen soll. Einigkeit besteht allerdings darüber, dass „es der Universität trotz Exzellenzinitiative und Bologna (wohl gerade wegen Bologna) schlecht geht“. Aber die Gesellschaft verlangt von der Universität nicht nur Wissen, Einsicht und Orientierung, sondern darüber hinaus auch eine Ausbildungsleistung, die solchen Vorstellungen zu entsprechen vermag. Denn nur die Universität verbindet die Forschung mit der Lehre, „weshalb ihr auch für eine Wissensgesellschaft eine wesentliche Bildungsaufgabe zukommt“. Denn Wissenschaft ist im Kern immer Bewegung, Veränderung, Reform. Sie ist das ständig Neue, das sich immer wieder aufs Neue seine eigenen Bedingungen schafft. Der universitäre Alltag aber atmet manchmal eine andere Wirklichkeit.
Wissensmanagement ist pure Erfolgsplanung
https://www.bod.de/buchshop/wissensmanagement-ist-pure-erfolgsplanung-joerg-becker-9783732231324
Eine Kommune handelt nicht nur als Eigentümer ihrer Liegenschaften, sondern gleichzeitig auch immer im gesamtstädtischen Auftrag. Deshalb spielt die Kommune bei der befristeten Entwicklung geeigneter Liegenschaften durch kulturwirtschaftliche Nutzungen eine große Rolle und ist entscheidend für Initiativen zur Mobilisierung von Raumpotentialen. Als Eigentümer verfügen Kommunen zudem bereits über weitreichende Erfahrungen mit Zwischennutzungen.
Eigenschaften, Fähigkeiten, Erfahrungen
Menschen in Organisationen sind keine passiven Gestaltungsobjekte, sondern Träger von Zielen, Bedürfnissen, Wertvorstellungen und der Möglichkeit des (re-)aktiven Handelns, was sich u.a. in der Aversion gegenüber (zusätzlicher) Steuerung und Kontrolle manifestiert. Die Ressource "Humankapital" weist eine Reihe charakteristischer Merkmale auf. Die kleinste Einheit des Wissensmanagements ist das Individuum als Träger von Fähigkeiten und Besitzer von Erfahrungen. Häufig ist der Organisation nur ein Teil dieser Fähigkeiten (z.B. Ausbildung, Sprachkenntnisse) bekannt. Diese bekannten Daten bilden aber nur einen Teil der Mitarbeiterfähigkeiten ab: wer die Fähigkeiten der Mitarbeiter nicht kennt, verpasst die Gelegenheit, sie zu nutzen (mangelnder Zugriff auf internes Expertenwissen). Erfolg hängt zuerst immer von Mitarbeitern ab: diesen ist wichtig, dass sie sich ernst genommen und gerecht behandelt fühlen. Als Mitarbeiter sind sie dann motivierter, engagierter und fester in das Unternehmen eingebunden. Sie fühlen sich auch für den Erfolg verantwortlich.
Mit Personalanalysen Eigenschaften, Fähigkeiten, Erfahrungen, Verhaltensweisen und Potenziale bilanzieren und beurteilen
Freelance growth vision
Eine radikale Änderung von Wirtschafts- und Lebensgewohnheiten scheint nicht nur naturwissenschaftlich und ökonomisch rational, sonders insgesamt unvermeidlich. Denn: zunehmender Konsum, Wirtschaftswachstum auf Basis fossiler Energieträger und Übernutzung von natürlichen Ressourcen verschlechtern immer weiter den Zustand der Ökosysteme. Die derzeitige Entwicklung droht aus dem Ruder und damit über Kipppunkte des Erdsystems zu laufen, die der Mensch seit Beginn seiner Siedlungszeit nicht erlebt hat. Eine der vielen Ursachen hierfür sind auch Preise, die nicht den ökologischen Kosten entsprechen. Denn ohne dass Preise an die Schöpfung und Zerstörung objektiver Werte gekoppelt sind, können Wachstum und unternehmerische Bilanzierung auch nicht Fortschritt anzeigen und Konsumenten keine informierten Entscheidungen treffen.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
Abi63 Bildungspotenziale ausgeschöpft?
Beim Bildungserfolg geht es nicht immer nur um Migrationshintergrund und soziale Herkunft als Bestimmungsfaktoren. Die zweite, ebenso bedeutsame Seite der Medaille ist die Schule an sich. Und hier insbesondere der sie tragende Lehrkörper. Wissensbilanzen mit Identifizierung des Intellektuellen Kapitals könnten vielleicht Aufschluss geben. Klassentreffen wirken nach Jahren danach quasi wie ein Langzeitlabor weit über lediglich eine Funktion der Routine und Kontaktpflege hinaus: wurden von der Schule angelegte Potenziale später ausgeschöpft?
Smart City? Und die anderen? Die ohne einen solch´ schmucken Beinamen? Wie nennt man die?
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
Team meetings
Bei der Vermessung von Schulqualität wurde im Rahmen statistischer Analyse beispielsweise auf die problematische Schülerzusammensetzung an den Sekundarschulen und den Gesamtschulen hingewiesen. An den Gymnasien finden sich etwa 75 Prozent Schüler mit Herkunftssprache Deutsch, 8 Prozent mit Türkisch und 17 Prozent mit anderen nichtdeutschen Sprachen. An den Gemeinschaftsschulen lag der Anteil der Schüler mit Deutsch als Herkunftssprache mit 56 Prozent am niedrigsten, 16 Prozent mit türkisch und 28 Prozent mit anderen Sprachen.
Intellektuelles Kapital - digitaler Striptease
Mit der Digitalisierung wurden große Versprechen (mehr Demokratie, Transparenz u.a.) in die Welt gesetzt. Es sind aber nicht Staat und Unternehmen transparenter geworden, sondern Bürger und Konsumenten frönen dem digitalen Striptease. Die Abschaffung von immer mehr Privatsphäre geht einher mit dem Erstarken unkontrollierter wirtschaftlicher und politischer Überwachungssysteme. „Und im freiheitlichen Westen stellt sich die Frage, welcher Konzern die Daten am umfassendsten aggregiert, um am Ende immer präzisere Profile über uns zu speichern und zu vermarkten. Es gibt kaum noch einen Bereich unseres Lebens und Schaffens, der nicht irgendwie digital aufgezeichnet wird. „Das Einzige, was momentan noch nicht digital analysiert werden kann, sind unsere Gedanken.
Um diese Entwicklung überhaupt erst einmal verstehen zu können, ist eine höhere Digitalkompetenz vieler Menschen notwendig. Um bewusst und selbstbestimmt entscheiden zu können, was wie mit unserer Privatsphäre geschehen darf und wie wir auf diese digitale Welt Einfluss nehmen können.
Intellektuelles Kapital von Personen und Standorten
Ecksteine der Standortentwicklung
Es bleibt immer weniger Zeit für eine gedankliche Auseinandersetzung mit nachhaltigen Standortanalysen. Es gibt keinen festen Halt mehr, keine sicheren Orientierungspunkte. Je mehr Daten es gibt desto sorgfältiger muss geprüft werden, wie wichtig, relevant, nützlich diese Daten sind. Hierfür braucht es neben Zeit auch Kompetenz.
Baupläne für Unverstandenes
https://www.bod.de/buchshop/bauplaene-fuer-unverstandenes-joerg-becker-9783756236107
Stellhebel der Kreativwirtschaft
Den Akteuren vor Ort stünde mit einer Standortbilanz ein Instrument für die Steuerung des Standortes zur Verfügung. Allerdings wäre die Kultur- und Kreativwirtschaft hierbei nur einer unter zahlreichen anderen Stellhebeln. Wenn man also aus grundlegenden Erkenntnissen heraus sich nun dieses Stellhebels bedienen will, steht man vor der weiteren Frage, wie genau dies zu bewerkstelligen wäre. Denn eines dürfte im Laufe der vorausgegangenen Überlegungen klar geworden sein: man hat es mit einem äußerst diffizilen Gebilde mit einer höchst komplexen Struktur zu tun. Für die Arbeit der Wirtschaftsförderung mag es zunächst genügen, dass man die Kultur- und Kreativwirtschaft als Quelle für originäre Innovationsideen und Vorreiter für ein immer mehr wissensbasiertes Wirtschaften entsprechend einordnet. Diese mehr übergeordnete Sicht der Dinge ist ohne weitere Einzelheiten jedoch nicht ausreichend. Ein in der Kommunalverwaltung gegebenenfalls eingerichtetes und zuständiges Dezernat für Kulturfragen hätte zusätzlich zu klären, wo genau und an welchen der vielen möglichen Ansatzpunkte man einwirken sollte. Auf eine breitere Basis könnte das Ganze gestellt werden, indem insbesondere die vielen Kleinstunternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft in ein hierfür aufzubauendes Expertennetzwerk eingebunden werden und somit in Form von „Coachings on the job“ die Professionalisierung vorangetrieben wird.
Regionalmarketing mit Clustermanagement
https://www.bod.de/buchshop/regionalmarketing-mit-clustermanagement-joerg-becker-9783739209333
Skills Consulting talents
Um Vielfalt und Qualität des kulturellen Angebots sicherzustellen, müssen die kommunalen Förder- und Vermittlungseinrichtungen ein Augenmerk auf die wirtschaftliche Stabilität der Kleinstunternehmen haben. Die Zwischennutzung von Liegenschaften und ungeplante Flächenbesiedlung erfolgt gleichzeitig mit einer Netzwerkbildung der Kulturschaffenden. Zusätzlich werden solche Standortgemeinschaften mit unternehmensnahen Dienstleistern ergänzt.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=5&q=J%C3%B6rg+Becker
Unterrichtsmethode
Gute Lehrer wissen: Die Unterrichtsmethode hat gegenüber dem Unterrichtsgegenstand immer eine dienende Funktion.. Das heißt, die Methode des Unterrichts leitet sich aus dem Lerngegenstand ab und nicht umgekehrt. Sie ist das Instrument, um einen fachlichen Gegenstand so darzubieten, dass ihn junge Menschen, denen das Thema neu ist, verstehen. Das Coronavirus hat dies besonders krass verdeutlicht. Selbst dort, wo digitale Methoden virtuos eingesetzt wurden, was allerdings häufiger nicht vorkam, konnten sie die Schule als sozialen Raum nicht ersetzen. Der direkte Kontakt mit ihren Lehrern und erst recht mit den Mitschülern hat zumindest den Schülern gefehlt, die nicht fortwährend gemobbt werden.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Transformation Lifescience
Die nachhaltige Stärkung des Intellektuellen Kapitals ist mit der wichtigste Faktor, um das Innovationspotenzial von Startups (und Standorten) noch besser auszuschöpfen. Prüfschema: Unsere Innovationen entstehen nicht zufällig,
wir besitzen einen fest definierten Innovationsprozess, der vom Management gesteuert wird, über die neuesten technologischen Entwicklungen bezogen auf unsere Produktionsprozesse sind wir gut informiert, der technologische Fortschritt in unserer Branche vollzieht sich langsam, wir sichern unser fachliches Knowhow über die Einbindung unserer bereits aus dem Unternehmen ausgeschiedenen Mitarbeiter.
Pandemie mit Schulschließungen
Insgesamt war die Schulschließung eine Zäsur, deren Folgen sich erst am Ende der Pandemie zeigen. Es gibt eine Kluft zwischen Kindern gebildeter Eltern und jenen, die zu Hause weder Ruhe noch einen Rückzugsort finden. Einmal mehr ist deutlich geworden, was Schule allein für den sozialen Ausgleich leistet. Ein Drittel des Schuljahres versäumt zu haben kostet viel Geld. Jedes zusätzliche Schuljahr erhöht das Lebenseinkommen eines Schülers im Durchschnitt um zehn Prozent. Die Lernverluste, die sich in einer geringeren Bildung künftiger Generationen spiegeln, schmälern nach Meinung von Experten das Sozialprodukt über viele Jahre um fast drei Prozent. Bei einem Erwachsenen-Pisa zeigten sich bei den Kurzschuljahrgängen selbst mit über 50 Jahren noch messbar geringere Mathematikkenntnisse und ein um ein bis fünf Prozent geschmälertes Lebenseinkommen.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=24&q=J%C3%B6rg+Becker
Sustainable Entrepreneurship
Digitale Plattformen sind und bleiben auch bei höchster Qualität kein Ersatz für den Sozial- und Lebensraum Schule. Eltern sind hier keine guten Ersatzlehrer, sondern wirken eher wie Konfliktbeschleuniger.

Startup-Betriebswirtschaft - Ressourcenlenkung und Schlüsselkompetenz
Den Kurs nach Marktrealitäten steuern
Direkt zum Buchshop:
Innovation Startup
Die Veränderungsprozesse der Digitalisierung lassen sich nicht als abgeschlossenes Projekt handhaben, sondern müssen als immerwährende Aufgabe gesehen werden.
Gründe für Veränderungen im Unternehmensbereich gibt es viele, beispielsweise:
Sinkendes Wachstum in bekannten Märkten
Verändertes Marktumfeld
Regulatorische Veränderungen
Technische Herausforderungen
Prüfschema Innovationen
Wir haben aufgrund unserer Produktionsprozesse keine Probleme damit, unsere Innovationen schnell marktreif zu machen?, es ist für unseren Vertrieb kein Problem, unsere Innovationen erfolgreich in den Markt einzuführen?, mit der Markteinführungszeit unserer Innovationen sind wir zufrieden?, mit der Marktdurchdringung unserer Innovationen sind wir zufrieden.?
Business Storytelling
Trends als Herausbildung kollektiver Verhaltensweisen sind manchmal auch ein Indikator für die Herausbildung gesellschaftlicher Konfliktlinien. Trends kursieren als Themen, gewissermaßen sind sie die Themen und besitzen in ihrer inhaltlichen Struktur eine gewisse Eigengesetzlichkeit. Wer solche Eigengesetzlichkeiten erkennt, kann sie für sich nutzen: für seine Vorstellungskraft über mögliche Zukunftsentwicklungen. Er kann Möglichkeitsräume erkennen, in denen Zukunft gestaltet werden kann. Möglichkeitsräume, die ansonsten vielleicht ungedacht und ausgeblendet geblieben wären.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=25&q=J%C3%B6rg+Becker
J. Becker Denkstudio
direkt zum Wissensmanagement:
direkt zur Region:
https://www.rheinmaingeschichten.de/
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Frankfurt Hanau BadHomburg Report

Ein Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs ist die Taunusbahn, mit der die Erreichbarkeit der Zentren in der Region Frankfurt-Rhein-Main hergestellt und gesichert wird. Im Hinblick auf die Qualität der Anbindung des Umlandes will man die weitere Siedlungsentwicklung auch auf die Bahn hin ausrichten. Durch eine Aufwertung der Achsen und des unmittelbaren Stationsumfeldes sollen weitere attraktive Wegebeziehungen geschaffen werden. Im Rahmen einer flächenhaften Anbindung von Siedlungsgebieten ohne direkten Bahnanschluss spielen die am Standort Friedrichsdorf vorhandenen Park-and-Ride-Kapazitäten eine wichtige Rolle.
Kreative Thematisierung Standortakteure
Die Standortakteure müssen in der Lage sein, die für sie relevanten Themen möglichst frühzeitig zu erkennen. Um sie durch eine erarbeitete Deutungshoheit und Themenführerschaft aktiv mitzugestalten. Proaktives Agieren ist eine zentrale Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit. Auf Seiten der Standortverantwortlichen heißt dies, potenziellen Investoren eine gute Story zu liefern. Für einen nachhaltigen Standorterfolg gehört nicht zuletzt die Fähigkeit zur erzählerischen Aufladung und kreativen Thematisierung.
Flüchtige Zusammenhänge
In turbulenten Zeiten verflüssigt sich alles Festetablierte. Es kommt darauf an, die wesentlichen Treiber der Veränderungen auszumachen und auch (vielleicht nur flüchtige Zusammenhänge) aufzuspüren. Als wesentliche Ursachen und Einflussfaktoren für die Zunahme der Umfeldturbulenz gelten Komplexität und Dynamik.
Rhein Neckar Main Agglomeration

Quelle „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Zeitschrift „Wirtschaftswoche“, IW Consult GmbH:
Ziel ist auch hier ein Vergleich von Standorten. Es geht darum, die Entwicklung der eigenen Region vergleichbaren Wettbewerbern gegenüberzustellen. Aufgrund der demografischen Entwicklungen stehen Städte nicht nur zueinander in Konkurrenz, wenn es um Standortentscheidungen von Unternehmen geht. Zukünftig geht es zusätzlich auch darum, die zahlenmäßig immer seltener anzutreffenden High Potentials für den eigenen Standort zu gewinnen, um daraus wiederum weitere Standortvorteile schöpfen zu können. Um im Standortwettbewerb zu bestehen, heißt es besser zu sein als andere
Disruption WorkLifeBalance
Technologischer Wandel (Digitalisierung, Internet der Dinge, Industrie 4.0, Vernetzung der Produktion, Online-Handel, Big Data u.a.) stellt sich die hierauf anpassenden Transformationen vor große Herausforderungen. Sowohl Industrie und Handel als auch Dienstleistungsbranchen werden hiervon erfasst.
Es geht nicht nur um Weiterentwicklungen von Produkten, sondern um eine teilweise völlig neue Gestaltung ganzer Angebotspaletten und Organisationssysteme: die Digitalisierung verändert die Grundpfeiler von Wirtschaft und Gesellschaft.
Hola Hanau - Abi63 Diversity
Überraschungen und unvorhergesehene Entwicklung sind an der Tagesordnung: Probleme und Ereignisse, die sich quasi über Nacht in das Bewusstsein drängen und mehr als alle vorherigen plötzlich nach (ungeteilter) Aufmerksamkeit verlangen. Ein Problem besteht für Standortakteure darin, die für sie strategisch wichtigen Umfeldentwicklungen auszufiltern. Denn schon allein aus Kapazitätsgründen können sie sich meist nur mit einer begrenzten Zahl der neu auf sie einstürmenden Tatbestände gleichzeitig auseinandersetzen. In den trivialen Niederungen von Standortthemen sollten die Erwartung an hierbei spektakuläre Erkenntnisse nicht zu hoch angesetzt werden.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=19&q=J%C3%B6rg+Becker
Transformation Digitalisierung Management
Ein Transformationsmanager muss immer wachsam und sensibel für sein Umfeld sein und muss den richtigen Zeitpunkt zum Handeln bestimmen können: die Transformation vom analogen zum digitalen muss bewältigt werden.
Zeiten der Transformationen sind Zeiten des (kontrollierten) Übergangs, die an Führungskräfte wie Mitarbeiter gleichermaßen besondere Anforderungen stellen und viel (zusätzliche) Aus- und Weiterbildung verlangen.
Von Nachteil wäre ein exzessiver Wandel, in dem sich Prozesse unkontrolliert überlagern: ein Transformationsmanager sollte (muss) genau wissen (erkennen), wie viel Wandel zumutbar und beherrschbar ist.
Voraussetzungen für erfolgreichen Wandel sind u.a.:
In jedem Fall die besten Leute halten
Über ein ausreichendes Finanzpolster (falls nicht vorhanden, könnte dies allein schon für Schwierigkeiten sorgen) verfügen können.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=6&q=J%C3%B6rg+Becker
Standort Bilanzierung - kommunal, regional
Für Standortbilanzen gibt es keine verbindlichen Vorgaben. Ausführung und Inhalt werden einzig und allein durch Informationsanforderungen des Wirtschaftsförderers und Standortentscheiders bestimmt. Wenn also Anwendungsinteresse besteht, muss jede Kommune, jeder Standort und jeder Investor eigene Wege gemäß den individuell anzutreffenden Gegebenheiten finden.
Eine Standortbilanz stellt Instrumente bereit, die eine ganzheitlich ausgerichtete Standortbestimmung auf lokaler und regionaler Ebene und damit die im Wettbewerb notwendige Schärfung des individuellen Standort-Profils unterstützen. Die Standortbilanz arbeitet als 360-Grad- Radarschirm für vielseitige Analysen und Beobachtungszwecke, mit dem insbesondere auch „weiche“ Standortfaktoren in einem übersichtlichen Gesamtrahmen identifiziert, gemessen und abgebildet werden können.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=5&q=J%C3%B6rg+Becker
HRG Hanau - Changemanagement
Wenn Wirtschaftsförderung und vor Ort agierende Unternehmen eine Vermessung des Standortes auf einer gemeinsam abgestimmten Plattform und Vorgehensweise vornehmen können, entsteht damit eine Kommunikationsbrücke zwischen Verwaltung und Wirtschaft mit der weitgehend vermeidbar wird, dass die Wirtschaftsförderung nicht oder zu spät von möglicherweise geplanten Abwanderungen erfährt. Oftmals geübte Kritikpunkte lassen sich damit vielleicht im Vorfeld entschärfen.
https://www.isbn.de/verlag/BoD+%E2%80%93+Books+on+Demand?autor=J%C3%B6rg+Becker&seite=1
Wenn sich Reichtum immer weniger aus fossilen Rohstoffen sondern immer mehr aus den immateriellen Rostoffen des Geistes (aus Erzählungen, die Dingen, Orten und Personen Wert verleihen) speisen würde, stünde der Kapitalismus vor einer Zeitenwende (ähnlich der Ablösung von Ackerland und Vieh durch Kohle und Erdöl).
Wissensbilanz - Strategie Management
Das Wissen, nicht genau zu wissen, was wir wissen, das „Denken des Undenkbaren“ zwischen Realität und Fiktion, wird von digitalen Wissenskulturen gewissermaßen selbst produziert. Im Umbau des kulturellen und sozio-technischen Gefüges der Digitalisierung aller Lebensbereiche werden sogenannte Sachzwänge zu einem Sachverhalt, von dem keiner mehr so recht sagen kann, was eigentlich Sache ist.
Vor diesem Hintergrund kann ein Wissensbilanz-Management-System dabei helfen, strategische Ziele zu erkennen und umzusetzen. Ein solches Planungssystem ermöglicht außerdem die langfristige Erolgskontrolle der angewandten Strategie. Um eine Messlatte zu haben, müssen vor der Implementierung eines Wissensbilanz-Systems erst die zu erreichenden Ziele definiert und die dafür notwendigen Mittel und Maßnahmen festgelegt werden. Die Performance wird dann über einen längeren Zeitraum an diesen Parametern gemessen, d.h. Daten werden gesammelt, analysiert und die Resultate in entscheidungsrelevanter Form aufbereitet.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=6&q=J%C3%B6rg+Becker
Zukunft leadership
Die Kultur des Wohlergehens kommt nur einer kleinen Gruppe von Menschen zugute: Menschen, die über bedeutende Kunstwerke verfügen, denkmalgeschützte Schlösser oder historisch rekonstruierte Innenstadtviertel. Der großen Mehrheit bleibt es vorbehalten, diesen Besitz lediglich intakt zu halten oder „die Kultur- und Ökotouristen zu empfangen, die allseits in geschichtsträchtig aufbereitete Immobilien strömen und diese profitabel halten“. Damit würden die Reichen ihren Reichtum nicht mehr nur aus der Ausbeutung der Armen schöpfen, sondern es würden alle immer reicher. Und das mittels des Rohstoffs, den wir alle pflegen, wenn wir schöne, gute, wahre Dinge herstellen, von ihnen sprechen und sie genießen: Kultur.
Standort realitätsgerecht vermessen
Ein möglichst realitätsgetreues Bild des Standortes muss aus den oft sehr verschiedenen Blickrichtungen eines Betrachters, also vor Ort ansässigen Unternehmen, kommunalen Verwaltungsstellen, ansiedlungs- und investitionsinteressierten Firmen oder Personen und Existenzgründern, zusammengefügt werden. Nur wer über alle Standortfaktoren genau im Bild ist und über sie detailliert und genau Buch führt, vermag damit zusammenhängende Risiken und Chancen in einem ausgewogenen Verhältnis zu steuern. Den unkalkulierbaren Gefahren von „Standort-Blindflügen“ kann am besten durch präzise und vollständige Vermessungen begegnet werden.
https://www.bod.de/buchshop/hoert-man-auf-treibt-man-zurueck-joerg-becker-9783756216109
J. Becker Denkstudio - Marketing Management
Standorte unterscheiden sich somit durch ihre Altersstruktur, die Fertilitätsraten und auch die Wanderungssalden. Für viele Standorte in Deutschland ist zu erwarten, dass das erforderliche Niveau, damit eine Elterngeneration ihre Müttergeneration ersetzt, unterschritten wird. Für die demografische Entwicklung im Einzelfall ist entscheidend, wie viele Menschen jeweils zu- bzw. abwandern. Der demografische Wandel ist somit ein wichtiger Indikator für potenzielle Standortunterschiede.
Es gibt einen „immateriellen“, „mentalen“ Kapitalismus, mit dem bisher als getrennt geltende Felder zu einer Einheit zusammengeführt werden. Obwohl sie sich ihre Zielgruppe teilen: „die Künste (deren Institutionen, Zuarbeiter, Studiengänge und Preise zunehmen), die Luxusindustrie (deren weltweite Exporte sich während der nuller Jahre fast verdoppelten) und den Tourismus.“ Gemeinsam bilden sie eine „Bereicherungsökonomie“, eine „Ökonomie der Vergangenheit“, in der der größte Profit nicht mehr in der Herstellung von möglich viel des Gleichen liege, sondern in sammlungswürdigen Einzelstücken und Erfahrungen.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=4&q=J%C3%B6rg+Becker
Region als Marke
Beispielsweise Nationalparks oder Weltkulturerbestätten. Eine solche Bereicherungsökonomie wäre auf der Vermarktung unkopierbarer Objekte und Erfahrungen aufgebaut. Eine Region würde als als Marke (branding) vermarktet und wäre dann die Summe aller Erzählungen, welche bestimmte Dinge mit einer solchen Regionalmarke (als quasi musealer Raum)verknüpfen.
Ernst Becker Stettin Hanau: Flugpionier
Warum haben die Pommern kein Glück gehabt? Obwohl sie nach ihrem Temperament, ihrer Mentalität und ihrer Art zu leben ein solches wohlverdient hätten
https://www.bod.de/buchshop/kreuzende-lebenslinien-joerg-becker-9783752820027
Spezialisierungsvorteile und deren Standortgegebenheiten sind Bestandteil der ökonomischen Rahmenbedingungen. Die Frage ist, ob eine Spezialisierung des Wachstums oder eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur der Standortentwicklung grundsätzlich förderlicher ist. Räumliche Nähe zu verwandten Branchen fördert regionale Wertschöpfungsketten. Viele Wirtschaftszweige können von brancheninternen Verflechtungen profitieren.
Standortanalyse Wissenstransfer
Durch Übertragungseffekte (Wissens-Spillover) können auch andere Branchen von einem Innovations-Pool des Standortes profitieren. Dabei fließt generiertes Wissen in Innovationen anderer Unternehmen ein (die nicht in derselben Branche tätig sein müssen). Rahmenbedingungen zur Stärkung der lokalen Wirtschaft bzw. zur Anwerbung von Unternehmen sind u.a.: gute Infrastruktur, überschaubarer bürokratischer Rahmen (z.B. Genehmigungsverfahren; Zuverlässigkeit, Berechenbarkeit und Schnelligkeit kommunalpolitischer Entscheidungen), Ansprechpartner für die Belange der Wirtschaft, unternehmensfreundliches Umfeld, Messen und Kongresse oder Kompetenznetzwerke.
Regionalmarketing - unabhängige Standortvermessung
Learning Training Inspiration
Leben heißt lernen und lernen heißt leben: zunächst war und ist die Schule der wichtigste (erste, einzige) Ort zum Lernen. In der Zukunft kommen die Netzwerke als weitere Orte hinzu. „Lernen ist der Erwerb von geistigen, körperlichen und sozialen Fähigkeiten und Kenntnissen, vor allem aber lernen wir durch die Reflexion von Erfahrungen“. Dabei tritt reines Faktenwissen mehr und mehr hinter Strategien- und Kompetenzerwerb zurück. Als hätten Schulen und ihre Schüler nicht schon nicht genug Probleme: sie stehen auch noch unter dauerhaft anhaltendem Reformstress. Schon lange wird die eigentliche Kerntätigkeit von Schulen überlagert von Belastungen durch „schulinadäquat erziehende Familien“ und einmischungsfreudige „Helikopter-Eltern in Bildungspanik“. Dieser für sich alleine schon riesige Problemberg wird noch zusätzlich überspült von immer schneller heran rauschenden politischen Reformwellen: mit hoher Frequenz wird geändert, rückgängig gemacht und erneut geändert.
https://www.bod.de/buchshop/catalogsearch/result/index/?p=9&q=J%C3%B6rg+Becker
Changemanagement mit Startup Mentalität
Mit Employer Branding werden die Werte eines Unternehmens erlebbar gemacht
https://www.bod.de/buchshop/potenzial-mit-wissen-joerg-becker-9783755778936
Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit haben schon in der Vergangenheit oft die Entwicklung der Welt bestimmt, in der Zukunft wird das kaum anders sein. Die angewandte Mathematik hat beispielsweise auch mit der Chaostheorie den Nachweis dafür erbracht, dass es physikalische Zustände gibt, die mittelfristig nicht vorhersehbar sind. Die Auseinandersetzung über Zufall, Ordnung, Unordnung und Komplexität gehört heute zum Alltag mathematischen Denkens. Das gilt nicht nur für Glücksspiele, sondern für viele Bereiche des täglichen Lebens.
Decision Support im turbulenten Umfeld
Die Horizonte verlässlicher Prognosen haben sich mit der Zeit verkürzt, zu turbulent ist das Geschehen. Doch trotz des Blicks auf ein verkürztes Zukunftsbild braucht es nach wie vor optimierte Entscheidungen. Auch wo sich das Umfeld als prinzipiell unvorhersagbar präsentiert, muss Zukunft gestaltet werden. Dabei ist schnelles Handeln nicht immer und jederzeit die beste Antwort auf neue Verhältnisse. Denn in einem turbulenten Umfeld sind es manchmal gerade die schnellen Entschlüsse, die sich im Nachhinein als übereilt und womöglich irreversibel erweisen. Eine nachhaltige strategische Planung muss auch mit plötzlich auftauchenden Irritationen fertig werden. Ansonsten besteht die Gefahr, durch abrupten Kurswechsel das strategische Gleichgewicht zu stören. Ein guter strategischer Plan kommt nicht allein mit quantitativen Informationen aus, gebraucht werden ebenso die qualitativen Informationen.
Allgemeines Wirtschaftswissen mit Blick auf Cashflow und Wertorientierung
direkt zum Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek
https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Becker+Lesebogen&method=simpleSearch
Sitemap
Kennzahlen Aussagen Potenzial
Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen setzt zunächst voraus, dass man sich der Grenzen ihrer Aussagefähigkeit bewusst ist. So darf nicht übersehen werden, dass Kennzahlen in ihrer mathematischen Formalisierung oft statisch sind und die Dynamik ablaufender Prozesse nicht immer genau zeitnah abbilden. Nicht aus dem Auge verloren werden sollte, dass vergangenheitsbezogene Kennzahlen nur bedingte Aussagen über die Gegenwart und noch weniger Aussagen über die Zukunft zulassen, statische Kennzahlen nur stichtagsbezogene Situationen widerspiegeln und damit nicht Bewegungsabläufe über Zeiträume erfassen können. Kennzahlen dürfen nicht isoliert interpretiert werden, sondern müssen sich einer bestimmten Systematik zuordnen lassen. Integrierte Kennzahlensysteme sind immer Mittel-Zweck-Beziehungen, die aus einem übergeordneten Zielsystem abzuleiten sind.
Globalisierung Krise - Denken im Wandel
Um vielfältige Krisen zu verstehen, muss man sich eine extrem breit angelegte Anschauungswiese zu eigen machen und Situationen immer aus einem ganzheitlichen Zusammenhang heraus analysieren. Um von statischen Strukturen hin zu dynamischen Strukturen des Wandels zu gelangen. Aus dieser Perspektive betrachtet, erscheinen Probleme oder Krisen als ein Aspekt der Umwandlung: es gibt einen Zusammenhang zwischen Krise und Wandel. In aufeinanderfolgenden Wachstumsphasen wiederholt sich ein Muster von Herausforderung und Antwort, das Konzept der fluktuierenden Strukturen.
https://www.bod.de/buchshop/wissensintensives-neudenken-joerg-becker-9783754374597
Hanau, Friedrichsdorf - Standortanalyse
In der Politik ist realer Decision Support häufig unerwünscht: externe Expertisen, die sie manchmal sogar selbst in Auftrag gegeben hat, werden von der Politik kaum oder eher flüchtig gelesen, geschweige denn befolgt. Im besten Fall werden sie zur Kenntnis genommen und dann im sogenannten demokratischen Procedere so zerfleddert und verfälscht bis sie zu nichts mehr taugen. Gegebenenfalls werden solche Expertisen noch als Vorwand für Missstände hergenommen. Wenn aber Expertisen bloß Ablenkungsmanöver sind, könnte man auch gleich ganz auf sie verzichten. Es gilt das alleinige Urteil des Marktes? Der in einem trügerischen Bild alles richtende Markt kann mit seinem Urteil auch sehr ungerecht werden. Und dies nach beiden Seiten hin. Das Band zu den individuellen Leistungen und Fähigkeiten eines Managers ist oft so locker, dass es manchmal kaum noch wahrnehmbar ist (manchmal gibt es überhaupt keines).
https://www.bod.de/buchshop/selektiv-joerg-becker-9783755792444
BigData ist nicht BigWissen
Unterschiedlichste Daten und selbst noch kleinste Datenschnipsel werden mosaikartig zusammengesetzt: was in einem Zusammenhang noch als nicht sensible Daten erscheinen mag, kann in einem anderen Mosaik höchst relevant werden. Es kommt immer auf den Verwendungszusammenhang an, der sich aufgrund der technischen Möglichkeiten in praktisch unendlich vielen Variationen und Kombinationen herstellen lässt. Bis die Buchdruckmaschine Einzug in die Welt hielt war das Privileg, lesen und schreiben zu können (entscheiden zu können, welches Wissen wichtig und welches unwichtig war) in den Händen weniger Geistlicher und Adliger. Der Buchdruck entzauberte diese Privilegien kurz und bündig. Analog hierzu erleben wir auch mit dem Internet so etwas wie eine Kommunikationsrevolution: ehemaliges Herrschaftswissen verliert dieses Status. Im Laufe der Zeit hat sich in der Welt mehr Wissen angesammelt, als irgendjemand irgendwann lesend bewältigen könnte. Beruhigend (und bedrohlich) wird versichert, dass das Internet nichts vergisst und auf ewig dort alles seinen Platz finde. Auf der einen Seite: die Angst vor Informationsverlust. Auf der anderen Seite: die Angst vor dem overload, der Informationsüberschwemmung: die Lobpreisung vom zukünftigen, grenzenlosen, selbstverwalteten, digitalen Paradies gepaart mit düsteren Untergangsszenarien.
EBook Engagement Storytelling
Kreativität in Räumen des Übergangs
Kultur- und Kreativmilieus bewegen sich oft in Räumen des Übergangs von aufgegebener Nutzung und noch nicht neu definierter Planung. In solchen Möglichkeitsräumen ist eine Umformung von Räumung und Gestaltung neuer „Szenen“ möglich. Dort, wo traditionelle Investorenkonzepte nicht greifen, können ganze Quartiere reaktiviert und als Kristallisationskern für neue Entwicklungen genutzt werden. Durch ein neu entstehendes Ambiente können zuvor vernachlässigte Gegenden aufgewertet werden.
Würde man solche Chancen verstreichen lassen, könnten zurückgelassene Areale durch fehlende Pflege und Vernachlässigung der Bausubstanz sich nicht nur selbst negativ entwickeln, sondern darüber hinaus eine negative Ausstrahlung auf ihr gesamtes näheres und weiteres Umfeld ausüben.
 derStandortbeobachter
Publikationen und Blog
Konzepte und Tools
Standortbilanz - Analyse
derStandortbeobachter
Publikationen und Blog
Konzepte und Tools
Standortbilanz - Analyse